|
||||||
Quelle: ENTSO-E |
||||||
April 2025 |
250401 |
ENERGIE-CHRONIK |
|
||||||
Quelle: ENTSO-E |
||||||
Der Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) hat am 28. April eine weitere Aufteilung der EEX-Handelszone in fünf Gebotszonen vorschlagen. Er stützt sich dabei auf einen Bericht (PDF) zur Überprüfung der Gebotszonen in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Schweden, der im August 2022 von der Europäischen Regulierungsbehörde ACER in Auftrag gegeben wurde. In diesem Bericht haben die Übertragungsnetzbetreiber der genannten Länder alternative Konfigurationen für Gebotszonen bewertet, die von ACER festgelegt wurden. Ein Änderungsvorschlag ergab sich aber nur für die Gebotszone Deutschland/Luxemburg.
Eine Gebotszone ist ein geografisches Gebiet innerhalb des Strommarktes, in dem Strom ohne Berücksichtigung physischer Netzbeschränkungen gekauft und verkauft werden kann. Die Überprüfung der Gebotszonen zielt darauf ab, optimale Konfigurationen für Gebotszonen in Europa festzulegen, um die wirtschaftliche Effizienz und die Möglichkeiten für den grenzüberschreitenden Handel zu maximieren und gleichzeitig die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten.
Gemäß der von ACER vorgegebenen Methodik zur Überprüfung der Gebotszonen ("Bidding Zone Review") wurden die Übertragungsnetzbetreiber aufgefordert, 14 alternative Konfigurationen anhand von 22 Kriterien zu bewerten, die in vier Kategorien unterteilt sind (Netzsicherheit, Markteffizienz, Stabilität und Robustheit der Gebotszone sowie Energiewende). Anhand der so ermittelten Befunde wurden die Gebotszonen-Konfigurationen dann nach dem Kriterium "Wirtschaftlichkeit" bewertet.
Die Überprüfung der Gebotszonen, wie sie von ACER beschlossen wurde, sah im
Fall Deutschlands vor, den status quo mit vier alternativen Konfigurationen
zu vergleichen. Als günstigste Lösung wurde die Konfiguration mit fünf Zonen
ermittelt, die im wesentlichen mit der Vier-Zonen-Lösung übereinstimmt, aber
die Region Schleswig-Holstein (grün) zu einer eigenen Gebotszone macht:
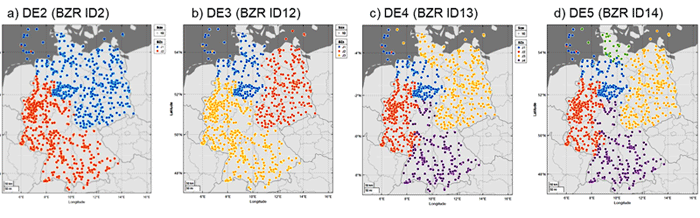 |
| 2 Zonen 3 Zonen 4 Zonen 5 Zonen |
Die farbigen Punkte markieren die Netzknoten, die den jeweiligen Gebotszonen zugeordnet wurden (Vergrößern)
"Der Vorschlag der Übertragungsnetzbetreiber für Zentraleuropa betont, dass dieses Ergebnis auf der von ACER definierten Methodik zur Überprüfung der Gebotszonen basiert und wichtige zusätzliche Aspekte nicht berücksichtigt", heißt es in der Mitteilung der ENTSO-E. "Daher sollte es nicht isoliert betrachtet werden, sondern in Verbindung mit bestimmten Überlegungen, die vor der endgültigen Entscheidung der von einer Aufteilung betroffenen Mitgliedstaaten über die künftige BZ-Konfiguration gründlich geprüft werden sollten, da sie erhebliche Auswirkungen auf die Auslegung und die Ergebnisse der von den Übertragungsnetzbetreibern durchgeführten Gebotszonen-Studie haben könnten."
|
|
In Skandinavien gibt es für Dänemark zwei, für Schweden vier und für Norwegen sogar fünf Gebotszonen. Nur für Finnland gilt flächendeckend ein einheitlicher Börsenstrompreis. Grafik: ENTSO-E |
Dieser eigenartige Hinweis lässt darauf schließen, dass die deutschen Übertragungsnetzbetreiber nur widerwillig zu den jetzt vorgelegten Ergebnissen gelangt sind und mit den Vorgaben der Europäischen Regulierungsbehörde zur Durchführung der "Bidding Zone Review" nicht einverstanden sind. Im übrigen überrascht das aber keineswegs, da Amprion schon im Februar den "Erhalt der einheitlichen Gebotszone im deutschen Strommarkt" verlangt hat. Der jetzige Vorschlag der ENTSO-E war damals zumindest in Kreisen der Übertragungsnetzbetreiber schon bekannt oder wenigstens absehbar. Als Alternative zur weiteren Aufteilung der EEX-Gebotszone hatte Amprion damals vorgeschlagen, die Kosten für den "Redispatch 2.0" und den Einsatz von Reservekraftwerken in den Bundeshaushalt zu übernehmen, um die Netzentgelte von den Milliardensummen zu entlasten, die jährlich durch das "Netzengpassmanagement" entstehen und die Strompreise belasten. Da Amprion unter den vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern eine koordinierende Funktion hat, dürften auch die drei anderen dieser Meinung sein.
Der Appell von Amprion an die neue Bundesregierung blieb nicht ungehört. Die Union war mit maßgeblichen Wirtschaftskreisen sowieso schon immer der Meinung, dass an der derzeitigen EEX-Gebotszone trotz aller Kosten zu Lasten der Stromverbraucher festgehalten werden müsse, bis die geplanten "Stromautobahnen" irgenwann doch noch fertiggestellt werden und die Netzengpässe entlasten. Und deshalb heißt es nun auf Seite 33 des Koalitionsvertrags, den Union und SPD am 9. April veröffentlichten: "Wir halten an einer einheitlichen Stromgebotszone fest" (250403). Die Union setzte sich damit gegen die Sozialdemokraten durch, die in der Verhandlungsgruppe "Klima und Energie" einen Neuzuschnitt der deutschen Stromhandelszone zumindest prüfen wollten, um die Milliardenkosten zu senken, die das bisherige Strommarktdesign verschlingt.
Diesen Gang der Dinge hat wohl auch die die Internationale Energie-Agentur (IEA) befürchtet, die am 7. April ihren Bericht zur energiepolitischen Situation in Deutschland vorlegte (PDF). Sie verwies dabei auf die noch anhängige Überprüfung der Gebotszonen in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Schweden, deren Ergebnisse in Kürze erwartet würden. Der neuen Bundesregierung riet sie vorsorglich schon mal, "keine politische Entscheidung zu treffen, die eine Aufteilung der Gebotszonen ausschließt".
Dieser Rat dürfte sich auf den § 3a der Stromnetzzugangsverordnung beziehen, der seit November 2017 die "Gewährleistung des Netzzugangs in der einheitlichen Stromgebotszone" vorschreibt und mitsamt der ganzen Verordnung zum Jahresende außer Kraft tritt (250203). Falls es die neue Bundesregierung riskieren würde, eine neue Verordnung dieser Art zu erlassen, wäre das eine Kampfansage an die EU-Kommission und auch eine Verletzung des europäischen Rechts. Seit dem 2021 ergangenen Urteil des Europäischen Gerichtshofs (210901) ist nämlich klar, dass es nicht im alleinigen Ermessen einer EU-Regierung liegen kann, über den Zuschnitt der sie betreffenden Strompreiszonen zu bestimmen. Maßgeblich dafür sind vielmehr die netztechnischen Realitäten des Strom-Binnenmarktes und die EU-Verordnung vom 5. Juni 2019, die in Artikel 14 bestimmt, dass die Gebotszonengrenzen mit Blick auf "langfristige, strukturelle Engpässe in den Übertragungsnetzen" festgelegt werden müssen. Das bedeutet, dass eine Strompreiszone auch mehrere Länder umfassen kann, wie das früher einmal mit Deutschland, Österreich und Luxemburg der Fall war. Ebenso kann es aber auch sinnvoll und notwendig sein, ein Land innerhalb seiner nationalen Grenzen in mehrere Strompreiszonen zu unterteilen, wie das schon vor zehn Jahren alternativ oder zusätzlich in Erwägung gezogen wurde, als es zur Abspaltung Österreichs von der EEX-Gebotszone kam (160201). Trotz ihrer forschen Willensbekundung im Koalitionsvertrag wird es deshalb die neue Bundesregierung vermeiden müssen, erneut eine einheitliche Stromgebotszone für Deutschland dekretieren zu wollen, wie das ihre schwarz-rote Vorgängerin im Jahr 2017 mit dem § 3a der Stromnetzzugangsverordnung getan hat, nachdem sie unter dem Druck der EU-Kommission und der Nachbarländer die Abtrennung Österreichs von der EEX-Gebotszone akzeptieren musste (171101).
zum Zuschnitt der Gebotszonen
zu den Kosten für das Engpassmanagement
Weshalb kommt es zu den Netzengpässen?Die Zunahme des Spotmarkt-Stromhandels ist der wichtigste, aber nicht der einzige Grund (siehe oben) Der gesamtdeutsche Stromverbrauch hat sich in den 35 Jahren seit der Wiedervereinigung nicht wesentlich verändert (siehe blaue Kurve in der Grafik 1). Im vergangenen Jahr war er mit 522 Terawattstunden sogar um 28 TWh geringer als 1990. Am Verbrauch kann es also nicht liegen, wenn sich die Netzengpässe ab dem zweiten Jahrzehnt so gehäuft haben, dass die Kosten für das sogenannte Engpassmanagement von 2011 bis 2024 um das 15-fache gestiegen sind (siehe Grafik 2). Das Stromtransportnetz ist auch nicht kleiner geworden, sondern deutlich größer: Im Jahr 1990 hatte das Höchstspannungsnetz (380 kV und 220 kV) eine Länge von insgesamt 28.786 Kilometer. Heute sind es rund 37.700 Kilometer. Es ist also rund ein Viertel umfangreicher. Und dadurch ist auch die Übertragungskapazität größer geworden. Dennoch wird diese verbesserte Netzstruktur trotz eines konstant gebliebenen oder sogar gesunkenen Stromverbrauchs seit dem zweiten Jahrzehnt immer häufiger von Stromflüssen überfordert. Wie die Grafik 1 zeigt, hat das offenbar mit der Leipziger Strombörse "EEX European Energy Exchange zu tun, die 2002 aus der Fusion von zwei Vorgänger-Unternehmen entstand (011008) und damals mit dem Spotmarkt-Handel begann. Die rote Kurve lässt erkennen, dass das gehandelte Volumen mit 31 TWh zunächst noch bescheiden war. Schon 2005 übertraf es aber mit 86 TWh das gesamte Erneuerbare-Aufkommen und ließ 2015 mit 254 TWh auch die konventionelle Stromerzeugung hinter sich. Ab 2019 war das Spotmarkt-Volumen sogar größer als der gesamte deutsche Bruttostromverbrauch und erreichte 2024 mit 880 TWh seinen bisherigen Rekord. Ein Großteil dieses Volumens dürfte auf grenzüberschreitende Lieferungen oder reine Transite zurückzuführen sein. Parallel dazu wurde – siehe grüne und graue Kurve – ein immer größerer Anteil des deutschen Stromverbrauchs mittels regenerativer Energien gedeckt, und zwar hauptsächlich mit Wind- und Solarstrom. Da Windkraft- und Solaranlagen in die Verteilernetze einspeisten, warnte die Bundesnetzagentur bereits in ihrem Monitoringbericht 2010, dass dies "in Verteilernetzen zu vorübergehenden Netzengpässen führen könne". Die Einspeiseorte der EEG-Anlagen würden "häufig nicht zur ursprünglichen Netzarchitektur passen". Eine als "Einspeisemanagement" bezeichnete Regelung in § 11 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG) erlaubte deshalb den Netzbetreibern seit 2009, EEG-Anlagen mit einer Leistung über 100 Kilowatt "zu regeln" bzw. ganz abzuschalten, falls ohne diese Maßnahme die Netzkapazität überlastet würde (080601). Im ersten Jahr nach Inkrafttreten dieser Bestimmung wurden so 73,7 Gigawattstunden Windstrom abgeregelt (zu 99,8 Prozent waren nur Windkraftanlagen betroffen) und die Betreiber nach § 12 EEG mit über sechs Millionen Euro entschädigt. Bis 2021 stieg diese "Ausfallarbeit" dann um fast das Achtzigfache auf 5.818 Gigawattstunden. Die dafür fälligen Entschädigungen erhöhten sich um das 134-fache auf 807,1 Millionen Euro. Große Mengen Windstrom wurde also erst gar nicht erzeugt, weil der von Jahr zu Jahr zunehmende Stromhandel die Engpässe im Netz verstopfte. Trotzdem wurden sie den Betreibern so vergütet, als ob sie erzeugt worden wären. Damit konnten sowohl die Netzbetreiber als auch die Betreiber von Windkraftanlagen gut leben, denn die Entschädigungen für die "Ausfallarbeit" wurden wie die normalen Einspeisevergütungen aus der EEG-Umlage bezahlt.
Die Verramschung des EEG-Stroms über die Börse verschärfte die Probleme nochAb 2010 trat eine weitere Regelung in Kraft, welche die Netzprobleme verschärfte und die EEG-Umlage zum Nachteil der Stromverbraucher noch mehr belastete: Es handelte sich um die "Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus des EEG (AusglMechV)". Diese Verordnung beseitigte das bisherige Verfahren, mit dem die ins Netz eingespeisten und per Festvergütung geförderten EEG-Strommengen mengen- wie kostenmäßig auf die Endverteiler und die Stromrechnungen von deren Kunden umgelegt wurden. Stattdessen wurden nun die Übertragungsnetzbetreiber beauftragt, den gesamten EEG-Strom zu erfassen und im vortägigen Spotmarkt- Handel an der Börse zu verkaufen. Damit entfiel der direkte Zusammenhang zwischen der EEG-Einspeisevergütung pro Kilowattstunde und den damit erzeugten Strommengen. Seitdem hängt es allein vom täglichen Börsen-Roulette ab, ob der erzielte Marktpreis überhaupt die Höhe der Einspeisevergütung erreicht oder sogar negativ wird. Im zweiten Fall müssen die Übertragungsnetzbetreiber sogar ein Aufgeld zahlen, um den Strom überhaupt loszuwerden. Schon bei der probeweisen Praktizierung der Neuregelung kam es Ende 2009 mehrfach zu Negativpreisen bis zu 500 Euro pro Megawattstunde und Verlusten in siebenstelliger Höhe (100101). Da die Neuregelung erst ab 2010 galt, durften diese Verluste noch nicht aus der EEG-Umlage bezahlt werden. Ersatzweise wurden sie von den Übertragungsnetzbetreibern unter "Systemdienstleistungen" verbucht, wodurch sie ebenfalls auf den Stromrechnungen der Endkunden landeten. Die Übertragungsnetzbetreiber wurden so ab 2010 zum größten Stromhändler am Spotmarkt, der entscheidend zur Steigerung des Handelsvolumens und damit auch zur weiteren Verengung der Netzenpässe beitrug. Ihr anfänglicher Marktanteil von etwa vierzig Prozent ging dann wieder zurück, als ab 2012 alternativ zu den festen Einspeisungsvergütungen die "Marktprämie" eingeführt wurde, die vor allem den Betreibern größerer EEG-Anlagen einen verstärkten Anreiz zur "Direktvermarktung" bieten sollte (130201). In der Folge sank der Marktanteil der Übertragungsnetzbetreiber, der 2011 noch bei 38 Prozent gelegen hatte, bis 2013 auf 23 Prozent. Eine weitere Gesetzesänderung sorgte dann dafür, dass die herkömmlichen Einspeisevergütungen ab 2016 nur noch für Bestandsanlagen bis 500 Kilowatt beansprucht werden konnten und neue Anlagen höchstens eine Nennleistung von 100 Kilowatt haben durften (140601). Für alle anderen Betreiber von EEG-Anlagen wurde die Direktvermarktung per Marktprämie verpflichtend. In ihrem Vorwort zum Monitoringbericht 2011 stellte die Bundesnetzagentur fest, "dass die Netze durch die Vielzahl der in den letzten Jahren zu erfüllenden Transportaufgaben und die Veränderung der Erzeugungsstruktur am Rand der Belastbarkeit angekommen sind". Das galt inzwischen nicht mehr nur für die Verteilernetze, sondern vor allem für das bundesweite Übertragungsnetz: Das Hauptproblem bestand darin, den im Norden Deutschlands immer üppiger anfallenden Windstrom über das Höchstspannungsnetz zu den Verbrauchschwerpunkten im Süden zu transportieren, weil es im Norden zu wenig Bedarf gab. Deshalb wurde nun in immer größerem Umfang das 2009 eingeführte "Einspeisemanagement" mit dem konventionellen "Redispatch" zur Überbrückung von Netzengpässen kombiniert. Das heißt, dass eine bestimmte Menge (Wind-)Strom, die auf der einen Seite des Netzengpasses abgeregelt werden muss,auf der anderen Seite durch Gas- oder Kohlekraftwerke neu erzeugt wird. Der am Spotmarkt verkaufte und dann wegen Netzengpässen nicht transportierbare Windstrom wurde also erst gar nicht erzeugt, aber von den Netzbetreibern als "Ausfallarbeit" vergütet. Auf der anderen Seite der Engpässe besorgten dann konventionelle Kraftwerke die Neuerzeugung derselben Strommenge. Auf diese Weise funktionierte der Spotmarkt-Handel scheinbar ebenso ungestört, als ob es innerhalb der deutschen Gebotszone gar keine Netzengpässe gäbe. Aus Börsensicht war damit alles wieder im Lot. Die Kosten dieser ebenso aufwendigen wie kostspieligen Redispatch-Prozeduren belasteten nämlich nicht die Börse oder deren Kunden, sondern wurden über die Netzentgelte auf die Stromverbraucher abgewälzt. Auf diese Weise werden real vorhandene Netzengpässe bis heute quasi virtuell überbrückt, um die Börsen-Fiktion eines engpassfreien Netzes innerhalb der deutschen Gebotszone aufrechterhalten zu können. Denn für den Stromhandel am Spotmarkt ist es von entscheidender Bedeutung, dass eine kontrahierte Strommenge unabhängig von real vorhandenen Hindernissen zum vereinbarten Zeitpunkt übertragen werden kann. Wie das technisch vor sich geht und trotz real existierender Netzengpässe doch gelingt, braucht weder Anbieter noch Käufer zu interessieren. Die zusätzlichen Kosten für die scheinbare "Überbrückung" von Netzengpässen tragen schließlich die Stromverbraucher. Schon 2011 verwies die Monopolkommission auf die Alternative, die dem jetzigen Vorschlag der ENTSO-E zugrundeliegt
Insgesamt umfasst der europäische Strommarkt derzeit 30 Staaten mit 43 Gebotszonen. Vier dieser Staaten verfügen über mehrere Gebotszonen: Dänemark (2), Schweden (4), Norwegen (5) und Italien (6). Dagegen haben Deutschland und Luxemburg eine gemeinsame Gebotszone, zu der bis 2018 auch Österreich gehörte. Dieses Unikum entstand aus der besonders engen stromwirtschaftlichen Verflechtung dieser drei Länder, die von keinen Engpässen an den grenzüberschreitenden Verbindungen beeinträchtigt wurde. Nach der 1998 in Deutschland (980401) und 2001 in Österreich (011005) erfolgten Liberalisierung des Strommarkts bezog die in Leipzig ansässige neue Strombörse EEX (011008) deshalb beide Nachbarländer in ihre Gebotszone mit ein. Bis dahin hatte es trotz der Liberalisierung des Strommarktes im deutsch-öterreichischen Netzgebiet keine nennenswerten Engpässe gegeben. Parallel zur ständigen Zunahme des Stromhandels war es dann aber mit der engpassfreien Zone bald vorbei. Hinzu kam das generelle Problem, dass mit der Beseitigung bzw. "Entflechtung" der früheren integrierten Stromversorgung die Gesamtverantwortung für die Abstimmung von Erzeugung, Netz und Verbrauch entfallen war. Daran konnte auch die Einrichtung einer Regulierungsbehörde, die in Deutschland erst mit großer Verspätung erfolgte, nur bedingt etwas ändern. Ein spezielles Problem ergab sich daraus, dass sich die besonders ertragreiche Einspeisung aus Windkraft im Norden Deutschlands konzentriert, aber oft nicht zu den Verbrauchsschwerpunkten im Süden transportiert werden kann, weil der dafür erforderliche Netzausbau zu langsam vorankommt. Dabei hatte es die Monopolkommission schon 2011 für falsch gehalten, die aufgrund des Spotmarkt-Handels entstandenen Netzengpässe durch den Bau von "Stromautobahnen" beseitigen zu wollen: Die bessere Lösung sei es, wenn für den Stromhandel innerhalb Deutschlands mindestens zwei Preiszonen eingeführt würden (110907 und Hintergrund). Sie verwies damit auf die alternative Lösung, die jetzt dem Vorschlag der ENTSO-E zugrundeliegt, die EEX-Handelszone in fünf separate Gebotszonen aufzuteilen (siehe oben). Nichtsdestoweniger beharren die maßgeblichen Kreise von Politik und
Wirtschaft bisher darauf, dass die Beibehaltung einer deutschlandweit
einheitlichen Gebotszone die beste Lösung wäre. Als im Juli vorigen
Jahres zwölf namhafte Energieökonomen einen Artikel unter der Überschrift
"Der deutsche Strommarkt braucht lokale Preise" veröffentlichten,
reagierte darauf gleich ein Dutzend Spitzenverbände ziemlich allergisch
mit einem "Gemeinsamen Appell führender Wirtschaftsverbände zum
Erhalt der deutschen Stromgebotszone". Darunter befanden sich mit
BDEW, VKU, VIK und BEE die wichtigsten stromwirtschaftlichen Verbände.
Hinzu kamen Industrieverbände wie BDI, VDA, VCI und ZVEI. Etwas später
gesellten sich auch noch die drei großen DGB-Gewerkschaften IGM, IGBCE
und Verdi zu den Unterzeichnern (240704).
|