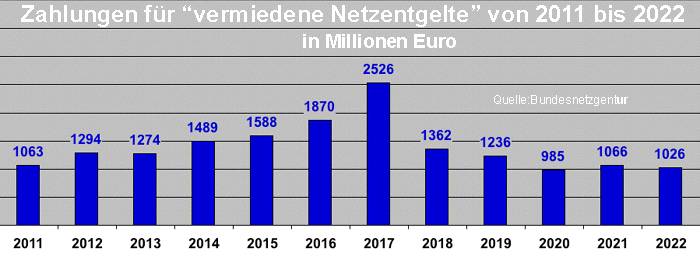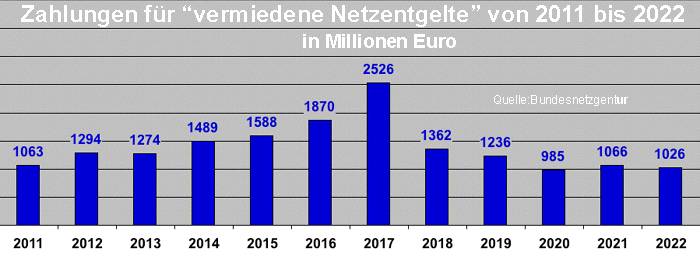 |
| Die Kosten der "vermiedenen Netzentgelte" stiegen unentwegt
und erreichten 2017 mit 2,526 Milliarden Euro ihren Höhepunkt. Dann wirkten
sich die Abstriche durch das "Netzentgeltmodernisierungsgesetz"
aus, das zwar die Zahlungen für Neuanlagen ab 2023 beseitigte, für Bestandsanlagen
aber auf dem Stand des Jahres 2016 weiterhin gewährte. Deshalb müssten
die Stromverbraucher noch viele Jahre lang mit einer jährlichen Belastung
von rund eine Milliarde Euro rechnen, falls es nicht zu der von der Bundesnetzagentur
geplanten stufenweisen Abschaffung bis 2029 kommt. |
Bundesnetzagentur will die Zahlungen für "vermiedene Netzentgelte" endlich
abschaffen
Die Bundesnetzagentur unternimmt einen neuen Vorstoß zur Abschaffung der Prämien,
die seit zwanzig Jahren aufgrund von §
18 Abs. 1 der Stromnetzentgeltverordnung die Betreiber kleinerer konventioneller
Kraftwerke erhalten, weil deren Anlagen nicht in das Höchstspannungsnetz einspeisen
(220 bis 380 Kilovolt), sondern in eines der nachgelagerten Verteilernetze (400
Volt bis 110 Kilovolt). Am 23. April legte sie den Entwurf für eine entsprechende
Festlegung vor. Demnach würden diese Zahlungen, die schönfärberisch als Vergütung
für angeblich "vermiedene Netzentgelte" begründet werden, ab 1. Januar 2026
jährlich um 25 Prozent abgesenkt werden und ab 2029 ganz entfallen. Bisher machen
sie ungefähr drei Prozent der Netzkosten aus und belaufen sich jährlich auf
rund eine Milliarde Euro. Die Netznutzer würden so in den Jahren 2026 bis 2028
um ca. 1,5 Milliarden Euro entlastet und danach jedes Jahr um bis zu einer Milliarde
Euro.
Es gab noch nie einen vernünftigen Grund, die Einspeisung von kleinen Kraftwerken
ins Verteilernetz extra zu belohnen
Die Bundesnetzagentur begründet die Abschaffung dieser unnötigen Belastung
der Stromverbraucher folgendermaßen:
"Die Vergütung für dezentrale Erzeugung
wurden vor über 25 Jahren in der Annahme eingeführt, lokal erzeugter Strom
würde auch lokal verbraucht und somit die Gesamtnetzkosten senken, da die
übergeordneten Netze nicht genutzt werden müssten. Diese Annahme stimmt immer
weniger. Auch dezentral erzeugter Strom wird zunehmend über längere Strecken
in die Verbrauchszentren transportiert. Zusätzlich müssen auch nachgelagerte
Netze so ausgebaut sein, dass eine Region aus den vorgelagerten Netzen versorgt
werden kann, etwa wenn dezentral angeschlossene Erzeugungsanlagen nicht verfügbar
sind."
Diese Argumentation ist im Prinzip richtig. Sie klingt aber fast so, als ob
die "vermiedenen Netzentgelte" einst von der Bundesnetzagentur erfunden worden
seien und sich die Haltlosigkeit dieser Fiktion erst im Laufe der Zeit herausgestellt
habe. Indessen gab es noch nie einen vernünftigen Grund, die Kraftwerksbetreiber
extra dafür zu belohnen, daß sie ihre Anlagen in die jeweils geeignete Netzebene
einspeisen lassen. Und das ist nun mal für kleinere Erzeugungsanlagen das Verteilernetz.
Fragwürdige Bonus-Zahlung sollte als netztechnisch sinnvoll erscheinen
Es war auch nicht die Bundesnetzagentur, die das Konstrukt der "vermiedenen
Netzentgelte" erfunden hat, denn diese Behörde gab es damals noch gar nicht.
Vielmehr war das die Branchen-Lobby, der es nach der 1998 dekretierten Liberalisierung
des Energiemarktes (980401) weitgehend überlassen worden
war, den neuen gesetzlichen Rahmen durch ein selbst geschneidertes Regelwerk
von "Verbändevereinbarungen" auszufüllen. Denn in Deutschland wollten die damaligen
Bundesregierungen hartnäckig am Sonderweg des "verhandelten Netzzugangs" festhalten
und waren sogar stolz darauf, keine Regulierungsbehörde eingeführt zu haben,
wie das in allen anderen EU-Staaten bereits geschehen war.
Um die inhaltliche Ausgestaltung dieser insgesamt drei "Verbändevereinbarungen"
gab es ein jahrelanges Tauziehen zwischen den unterschiedlichen Interessengruppen
der Strombranche. Unter anderem ging es darum, den KWK-Anlagen von Stadtwerken
und anderen kleineren Stromversorgern, die infolge der Liberalisierung unwirtschaftlich
zu werden drohten, einen Bonus zukommen zu lassen. Dabei traf es sich gut, daß
diese unterhalb der Höchstspannungsebene einspeisen. So ließ sich eine an sich
nicht begründbare Prämie zu Lasten der Stromverbraucher als netztechnisch notwendige
oder zumindest erwünschte Förderung der dezentralen Einspeisung kaschieren.
Der Begriff tauchte erstmals 2001 in der dritten Verbändevereinbarung auf
In der zweiten Verbändevereinbarung vom Dezember 1999 – im Branchenjargon VV
II genannt – findet sich deshalb unter Ziffer 2.3.3 erstmals ein besonderes
Entgelt für die Stromeinspeisung aus "dezentralen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen".
Ausdrücklich ausgenommen wurden dagegen solche Anlagen, deren Erzeugung durch
das damals geltende "Stromeinspeisungsgesetz" gefördert wurde, hauptsächlich
also Solar- und Windkraftanlagen.
In der dritten Verbändevereinbarung vom Dezember 2001 – der sogenannten VV
II plus – ist diese Regelung unter Punkt 2.3.3 ebenfalls enthalten, wobei
erstmals der Begriff "vermiedene Netzentgelte" verwendet wird. Als neues Ausschluß-Kriterium
für die Gewährung der Prämie galt nun die Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG), das mittlerweile das Stromeinspeisungsgesetz abgelöst hatte. Dagegen
beschränkte sich nun die Vergütung nicht mehr auf KWK-Anlagen, sondern galt
generell für "dezentrale Erzeugungsanlagen", soweit sie keinen EEG-Strom erzeugen.
Mit der Stromnetzentgeltverordnung wurde die Fiktion "vermiedene Netzentgelte"
rechtlich anerkannt
Als 2005 das Konzept des "verhandelten Netzzugangs" endgültig scheiterte (050701),
gelang es der Branchen-Lobby, die bisherige Praxis der Verbändevereinbarungen
vielfach unverändert in die neuen gesetzlichen Bestimmungen zu übertragen (071102).
So wurden auch die Kalkulationsprinzipien der neuen Stromnetzentgeltverordnung
(StromNEV), die nun die Bundesregierung beschloss, weitgehend aus der zuletzt
gültigen VV II plus übernommen. Deshalb gelangten mit dem Prozedere zur Ermittlung
der Netzentgelte auch die Vergütungen für "vermiedene Netzentgelte" in den §
18 Abs. 1 der Stromnetzentgeltverordnung. Sie wurden damit rechtsverbindlich,
während sie bisher nur eine Art Richtschnur darstellten, an die man sich halten
konnte oder nicht, denn Rechtsansprüche oder Sanktionsmöglichkeiten bei Nichteinhaltung
ergaben sich aus den Verbändevereinbarungen nicht.
Zusätzlich wurde die EEG-Umlage mit Pseudo-Zahlungen" belastet
Bei dieser rechtlichen Verankerung der Fiktion "vermiedene Netzentgelte"
in der Stromnetzentgeltverordnung blieben EEG-Anlagen weiterhin von der Vergütung
ausgenommen, obwohl sie einen immer größeren Beitrag zu der angeblich bezweckten
Dezentralisierung der Stromeinspeisung leisteten. Um dem Vorwurf einer unzulässigen
gesetzlichen Diskriminierung vorzubeugen, wurde deshalb nachträglich der Anschein
erweckt, als ob für EEG-Anlagen die vermiedenen Netzentgelte bereits in den
Vergütungen für den EEG-Strom enthalten seien: Nach §
57 Abs. 3 des 2014 novellierten Erneuerbare-Energien-Gesetzes hatten nun
die Verteilnetzbetreiber auch für EEG-Anlagen die vermiedenen Netzentgelte zu
ermitteln und an den jeweils vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber auszuzahlen.
In der Praxis ging das so vor sich, daß die Übertragungsnetzbetreiber die errechneten
Summen von den EEG-Vergütungen abzogen, die sie den Verteilnetzbetreibern überwiesen.
Was vordergründig dem EEG-Konto zufloss, war also in Wirklichkeit eine verkappte
Erhöhung der EEG-Umlage, die über die Erhöhung der Netzkosten zustande kam.
Bundesnetzagentur forderte schon vor zehn Jahren die Streichung der gesamten
Regelung
Das System der vermiedenen Netzentgelte sei "nicht mehr sachgerecht" und führe
sogar zu "einer sich selbst verstärkenden Kostenspirale", konstatierte die Bundesnetzagentur
in einem Positionspapier zur Netzentgeltsystematik vom Juni 2015. Es müsse deshalb
insgesamt abgeschafft werden:
"Vermiedene Netzentgelte führen zu einer sich selbst verstärkenden
Kostenspirale. Durch verstärkte dezentrale Erzeugung wird die bestehende Kapazität
des vorgelagerten Netzes in einem geringeren Umfang genutzt. Die weiterhin
bestehenden Infrastrukturkosten werden auf eine geringere Absatzmenge verteilt.
Dies führt zu einem Anstieg der Netzentgelte auf der vorgelagerten Netzebene.
Damit steigen wiederum die vermiedenen Netzentgelte, da diese sich an den
Netzentgelten der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene bemessen. Die Infrastrukturkosten
des vorgelagerten Netzes, die zum großen Teil Fixkosten darstellen, verringern
sich jedoch dadurch nicht."
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wollte dagegen
nur die Pseudo-Vergütungen für EEG-Anlagen streichen und hoffte wohl, mit diesem
Bauernopfer die real ausgezahlten Prämien für seine betroffenen Verbandsmitglieder
retten zu können. Die ostdeutschen Bundesländer verlangten sowieso die sofortige
Abschaffung dieses besonders unsinnigen Konstrukts, weil es die überdurchschnittlich
hohen Netzkosten in ihrem Gebiet noch mehr erhöhte und so die Stromverbraucher
belastete (160501).
Der Lobby gelang es mehrfach, die Abschaffung zu verhindern, zu verschieben
oder zu verwässern
Der anfängliche Entwurf des "Strommarktgesetzes" (151103)
sah zwar die Streichung der Prämien für "vermiedene Netzentgelte" vor, wollte
sie aber lediglich für neue Anlagen und erst ab 2021 wirksam werden lassen.
Er zielte damit weniger auf die Abschaffung der Regelung als auf deren möglichst
lange Aufrechterhaltung. Aber selbst dazu kam es nicht (160604).
Ein weiterer Gesetzentwurf sah vor, die Prämien ab 2021 nur für Neuanlagen zu
streichen und erst 2030 generell zu beenden (161110).
Das Anfang 2017 beschlossene "Netzentgeltmodernisierungsgesetz" beseitigte dann
ab 2020 die Pseudo-Vergütungen für EEG-Anlagen sowie die Prämien für Neuanlagen
ab 2023, gewährte aber für Bestandsanlagen weiterhin die bisherigen Zahlungen
auf dem Stand des Jahres 2016 (170604).
Mit dem Entwurf des Gesetzes zur Einführung einer "Strommarktbremse",
das der Bundestag im Dezember 2022 beschloss, sollte dann die absurde Vergütung
endlich ganz abgeschafft werden. Dazu kam es aber doch nicht, weil der Ausschuss
für Klima und Energie in der Beschlussempfehlung, die er einen Tag vor der Plenarsitzung
vorlegte, die Streichung der Streichung empfahl (221208).
Die Lobby war also wieder mal erfolgreich am Werk gewesen.
Wird das auch jetzt wieder so sein? – Vermutlich nicht, da der Bundesnetzagentur
inzwischen erweiterte Kompetenzen eingeräumt wurden und im Zusammenhang damit
die Stromnetzentgeltverordnung zum Jahresende sowieso außer Kraft tritt (231109).
Es ist deshalb davon auszugehen oder zumindest zu wünschen, dass der Regulierungsbehörde
zehn Jahre nach ihrem ersten Vorstoß endlich die komplette Abschaffung dieser
Altlast aus den ersten Jahren nach der Liberalisierung des Strommarkts gelingt.
Links (intern)
- Streichung der "vermiedenen Netzentgelte" wurde gestrichen (221208)
- "Vermiedene Netzentgelte" belasten die realen Netzentgelte in
Milliardenhöhe (181205)
- Netzentgeltmodernisierungsgesetz ist "bestenfalls ein Reförmchen" (170604)
- Belastung durch "vermiedene Netzentgelte" soll erst 2030 auslaufen (161110)
- Bei den "vermiedenen Netzentgelten" ändert sich vorerst nichts (160604)
- Ostdeutsche Länder verlangen sofortige Streichung der "vermiedenen
Netzentgelte" für EEG-Anlagen (160501)
- Hintergrund: Sind Prämien für dezentrale
Stromeinspeisung sinnvoll? (Mai 2016)